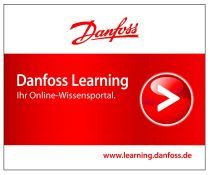Einmalige Entscheidungen richtig treffen
In endlicher Zeit rationale Entscheidungen treffen, ohne endlos auf die perfekte Gelegenheit zu warten
Unternehmer wägen insbesondere bei wichtigen, langfristigen Entscheidungen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig ab. Wie aber soll auf eine, möglicherweise einmalige Chance reagiert werden? Ein sehr guter Bewerber, mit dem man eine schon lange offene Position besetzen könnte, oder ein interessantes Gebäude, das zur Betriebsvergrößerung angeboten wird? Je attraktiver das Angebot, umso schneller werden allerdings auch andere Interessenten zugreifen. Der optimale Zeitpunkt, die bestmögliche Offerte zu finden, ist Glücksache. Allerdings bestehen Möglichkeiten, vielleicht keine perfekte, aber eine gute Entscheidung zu treffen und schwerwiegende Fehler auszuschließen. Das passende Instrument wird im weiteren Beitrag vorgestellt.
Grenzen üblicher Entscheidungsmodelle
Die meisten wichtiger Entscheidungen eines Unternehmers sind Investitionen bzw. Desinvestitionen. Soll die Immobilie A oder B als neuer Firmensitz erworben werden? Sollen die Fahrzeuge zukünftig vom Hersteller x oder y gekauft werden? Auch die Einstellung eines neuen Mitarbeiters kann als „Investition“ betrachtet werden. Soll dem ersten Kandidaten zugesagt oder auf bessere gehofft werden? Desinvestitionen fallen ebenfalls hierunter. Ist der Preis für die Immobilie hoch genug oder besteht Hoffnung auf eine bessere Offerte?
Die Prämissen der üblichen Entscheidungsmodelle sind bekannt: für wichtige Entscheidung werden Alternativen eingeholt, eine Mindestanzahl an Angeboten festgelegt, dann wird gerechnet und miteinander verglichen, verhandelt und der leistungsfähigste Anbieter beauftragt. In der Praxis erschwert ein Kriterium oft dieses Vorgehen: die Anzahl der Handlungsmöglichkeiten, der Alternativen. Häufig besteht eine große Anzahl von Möglichkeiten, wobei die genaue Anzahl nicht bekannt ist, auch nicht bekannt sein kann. Wenn einzelne Möglichkeiten verglichen und bewertet wurden, kann sich anschließend vielleicht eine noch bessere Alternative ergeben. Ebenso werden allerdings Gelegenheiten verstreichen, die sich in der Rückschau als besonders interessant herausstellen. Das Problem ist, dass eine Möglichkeit meistens nicht unbeschränkt, nicht dauerhaft bestehen bleiben. Tabelle 1 systematisiert verschiedene Entscheidungsvorgänge, wobei unter dem Begriff „Kauf“ auch die Einstellung von Mitarbeitern subsumiert wird.
Die Unterschiede lassen sich leicht herausstellen. Wird eine neues Fahrzeug erworben, gibt es die Anzahl der bekannten Hersteller, die miteinander im Wettbewerb stehen, deren Angebote blieben eine Zeitlang gültig, so dass der Unternehmer die Alternativen quantifizieren und seine Entscheidung in Ruhe treffen kann. Soll eine Immobilie erworben werden, ist die Situation komplexer. Kurzfristig gibt es mehrere Angebote, fünf Wochen später ist nichts Adäquates mehr am Markt. Angebote haben nur kurzen Bestand, wer nicht entschlossen zugreift, kommt zu spät. Aber wie lange soll der Markt beobachtet werden, wie lange auf ein, möglicherweise noch besseres Angebot gewartet werden? Dass die Anbieter bewusst den Druck auf potenzielle Käufer erhöhen, die Attraktivität, ja Einmaligkeit ihrer Offerte betonen, gehört zum bekannten Procedere. Wie soll ein Interessent entscheiden? Was konkret tun, wenn er seit vier Monaten neue Betriebsräume sucht und nun von einem Makler ein interessantes Angebot erhält, welches aber nur eine Woche besteht, da auch andere Interessenten vorhanden sind?
Keiner kann mit Sicherheit wissen, ob vielleicht eine (noch) bessere Entscheidung möglich sei, möglich gewesen wäre. Irgendwann muss jedoch eine Entscheidung fallen. „Einen Tod muss man sterben“ ist die nicht unpassende Umschreibung dieser Lage. Die Lösung kommt aus einer unerwarteten Richtung …
Eine Geschichte aus dem Morgenland
Die aufgezeigte Herausforderung beschäftigt Menschen seit langen Zeiten. Eine klassische Lösung bietet das Mitgiftproblem.
Sultan Saladin sucht einen neuen Berater. Den Kandidaten wurden zur Prüfung jeweils 100 junge Frauen vorgestellt. Jeder Bewerber sollte die Frau mit der höchsten Mitgift auswählen. Die Frauen traten einzeln vor und nannten ihre Mitgift, wobei die Reihenfolge des Auftritts zufällig war. Der Kandidat musste direkt entscheiden, ob er eine Frau auswählte oder nicht. Bei Ablehnung kam die nächste Frau an die Reihe, wobei der Kandidat nicht auf bereits vorgestellte Frauen zurückgreifen konnte. Wählte der Betreffende nicht die Frau mit der höchsten Mitgift, wurde er den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Konnte ein einzelner Kandidat überhaupt etwas tun, um die Chancen von 1 zu 100 zu verbessern?
Die optimale Vorgehensweise ist relativ einfach: Der Kandidat lässt die ersten 37 Frauen vorübergehen, merkt sich die höchste Mitgift, die bis dahin genannt wurde, und wählt die nächste Frau aus, deren Mitgift diesen Wert übertrifft. Damit erhöht sich die Chance, die richtige Frau zu finden von 1 % auf 33 %. Zu Berechnung dieses Wertes wird die Eulersche Zahl eingesetzt, die Basis des natürlichen Logarithmus. Sie beträgt 2,71828…:
Die Zahl der Alternativen (hier 100) wird durch die Eulersche Zahl geteilt, womit sich der Wert 37 ergibt.
Das Mitarbeiter-Problem
Eine mathematische Ableitung der optimalen Vorgehensweise führt das sogenannt „Mitarbeiter-Problem“ aus, welches den Auswahlprozess eines Mitarbeiters behandelt. Martin Flood fand 1958 die mathematische Lösung der optimalen Entscheidung bei vergänglichen Lösungen bzw. einmaligen Problemen.
Das Grundproblem ist das gleiche wie bei der Brautwahl: Kälte-Klima-Fachbetriebe, die Mitarbeiter einstellen, können zwei Fehler begehen: sie können die Suche nach einem neuen Mitarbeiter zu früh oder zu spät beenden. Es gilt den optimalen Zeitraum für das „Schauen“ (die Datensammlung) festzulegen und in dieser Zeit keinen Bewerber einzustellen.
Gibt es nur einen Bewerber, ist die Entscheidung einfach: dieser wird eingestellt. Bei zwei Bewerbern liegt die Chance, den Besten einzustellen, bei 50 %. Interessant wird der Sachverhalt, wenn ein dritter Bewerber hinzukommt. Handlungsmacht besteht nicht mehr, wenn den beiden ersten Kandidaten abgesagt wurde – also muss der Dritte eingestellt werden. Beim zweiten Bewerber gibt es jedoch diese Handlungsmacht, wenn auch nicht vollkommen. Der Entscheider weiß, dass der dritte Kandidat besser oder schlechter als der erste ist und kann wählen, ob er diesen ablehnt oder einstellt. Die beste Strategie ist, diesen Kandidaten einzustellen, wenn er besser als der erste Kandidat ist und ihm abzulehnen, wenn er schlechter ist. Bei vier Bewerbern ist die Entscheidung nach zwei Gesprächen immer noch die beste, bei fünf Bewerbern jedoch nach dem Dritten. Tabelle 2 fasst die Ergebnisse nach Anzahl der Bewerber zusammen.
Wenn sich die Anzahl der Bewerber erhöht, stabilisiert sich der optimale Punkt zwischen weiterem Suchen und Entscheiden bei 37 %, der Eulerschen Zahl als mathematische Konstante*.
Praktisches Vorgehen
Werden Versuchsteilnehmer vor ähnliche Aufgabe gestellt, entscheiden diese meistens früher, somit zu früh. Sich Zeit nehmen, erste Angebote zur Marktsondierung nutzen und erst später entscheiden ist deshalb eine gute Empfehlung für Unternehmer. Dabei sollte die Anzahl der realistischen Möglichkeiten dokumentiert werden, um eine Einschätzung der Anzahl der möglichen Alternativen vorzunehmen und um diese anschließend in Relation zum maximalen Entscheidungszeitraum zu setzen.
Wenn ein Kälteanlagenbauer beispielsweise einen Lagerraum anzumieten sucht, kann eine Erfassung der relevanten Angebote über einen Monat erfolgen. Kommen in diesem Zeitraum z. B. fünf Angebote neu auf den Markt und soll in spätestens sechs Monaten eine Entscheidung fallen, würde in diesem Zeitraum ungefähr 30 Angebote vorliegen. Wird diese Zahl durch die Eulersche Zahl geteilt, sollte nach elf relevanten Angeboten das interessanteste Angebot dokumentiert sein. Das nächste Angebot, welches besser ist sollte angenommen. Vergleichbare Situationen finden sich häufig bspw. bei der dargestellten Mitarbeitersuche.
Dieses strukturierte, schablonenhaft wirkende Vorgehen erscheint bei wichtigen Entscheidungen befremdend. Mancher mag sich eine bessere Lösung vorstellen, diese kann es geben, ebenso aber das Gegenteil eintreten. Die Zeit läuft ab, der Entscheidungsdruck nimmt zu, nichts passiert und irgendwann muss entschieden werden. Der Algorithmus gewährleistet keine optimale Entscheidung, aber eine vernünftige, womit bereits entscheidendes erreicht und der Anspruch, eine rationale Entscheidung zu treffen, erfüllt wird, ohne der Illusion einer perfekten Entscheidung hinterher zu laufen.
Faustregeln
Die Suche nach bestimmten Sachgütern ist eine Sache, ebenso können sich Angebote und Gelegenheiten geben – einmalige die weder vorhersehbar noch planbar sind. Hier geraten Unternehmer schnell in eine Zwickmühle.
In solchen Situationen können Faustregeln genutzt werden, welche keine perfekte Entscheidung gewährleisten, aber zumindest helfen völlige Fehlentscheidungen zu vermeiden.
Finden Sie den wichtigsten Grund und vergessen Sie den Rest. Häufig weiß der Betroffene genau, was er sucht. Eine Immobilie soll in einem bestimmten Ortsteil liegen, das Fahrzeug von einem bestimmten Hersteller sein. Dann wird scheinbar objektiv entscheiden, allerdings bei anderen Möglichkeiten so lange nach Ablehnungsgründen gesucht, bis diese endlich gefunden sind. Die hierfür erforderliche Zeit kann man sich sparen.
Legen Sie ein Anspruchsniveau fest. Hier wählt der Entscheider die erste Alternative, die dieses Anspruchsniveau erfüllt und beendet seine Suche. Wenn eindeutig ist, was wirklich wichtig ist, was reicht, aber auch was unbedingt notwendig ist, muss nicht mehr Aufwand als notwendig getrieben werden.
Die innere Stimme: Werfen Sie eine Münze. Während diese fliegt, wird sich der Entscheider wünschen, welche Seite nicht oben liegen soll. Diese Bauchgefühl trügt selten. Manche Akteure machen sich selbst etwas vor. Zwar wirkt es unprofessionell, sich auf das eigene Bauchgefühl zu berufen, allerdings ist Bauchgefühl nicht mit spontanen Eingebungen zu verwechseln, sondern beruht auf jahrelanger Erfahrung. Ebenso können Experten um Rat gebeten werden. Dabei lautet die Frage allerdings nicht: Was empfehlen Sie mir?, sondern: Was würden Sie an meiner Stelle tun? Dass letztere Frage durchaus anders als die erste beantwortet wird, hat Gigerenzer bei Ärzten festgestellt.
Zusammengefasst gilt, das, was Benjamin Franklin für die Wahl des Ehepartners empfahl, auch für einmalige Entscheidungen: Halte die Augen vor der Heirat weit offen und halb geschlossen danach.
Nassim Taleb stellt zu Recht fest, dass nicht das Unternehmen überlebt, welches alles richtig macht, sondern das, dem kein entscheidender Fehler unterläuft.